|
Verschobene Grenzen:
Das umstrittene Westjordanland
Habbo Knoch
Das romantische Ensemble aus Olivenhainen, Haufendörfern
und Schafherden, sonst Sinnbild biblischen Friedens, ist im West-Jordanland nur
ein dünner Firnis des israelisch-palästinensischen Konflikts. Mit Parolen und
Zeichen übersäte Betonmauern haben die palästinensischen Orte des
Westjordanlands seit dem Beginn der Intifada 1987 zum Graffitiland
gemacht. Die Beschaulichkeit des samarischen Berglands mit seinen
grün-bräunlichen Hügeln und der schrofferen judäischen Berge wird abwechselnd
von Flüchtlingslagern und mehrfach befestigten israelischen Sicherheitsanlagen
durchbrochen.
Ähnlich festungsartig sind jüdische Siedlungen mit Wachposten
und doppeltem Stacheldraht gesichert. Im Innern bieten Garten, Spielplätze und
Schabbatruhe Lebensqualität pur. Ihre "Bauweise mit Fertigteilen beleidigt", so
der israelische Schriftsteller Amos Oz, "die Steine des Ortes, die man verwarf,
und verleiht der Siedlung einen israelischen Charakter, typisch für die Ebene,
die übliche Mischung aus nacktem oder verputztem Beton, Aluminium, Glas und
Plastik. Wie in den Vororten von Tel Aviv und Haifa." Mit diesen künstlichen
Fremdkörpern eignen sich israelische Siedler und Politiker, die auf einem
historischen Recht des jüdischen Volkes auf Judäa und Samaria beharren, den
Landstrich Stück um Stück an.
Das 1967 besetzte Westjordanland wurde schon in den ersten
Monaten nach seiner überraschenden Einnahme auch politisch okkupiert.
Partei-übergreifend wuchs die Entschlossenheit, es gar nicht mehr oder nicht
ohne entscheidende Zugeständnisse der arabischen Staaten herauszugeben. Judäa
und Samaria galten als "Wiege unserer Geschichte", wie Moshe Dayan 1967 bewegt
formulierte. Dayan, als Kommandeur der Hagana-Einheiten im belagerten
Jerusalem einer der Kriegshelden von 1948 und Generalstabschef der israelischen
Armee im Sinaikrieg, war kurz vor dem Krieg auf öffentlichen Druck hin zum
Verteidigungsminister ernannt worden und treibende Kraft bei der Entscheidung
für den Krieg gewesen. Seinem politischen Ziehvater, David Ben-Gurion, der lange
Zeit selbst von einem Israel geträumt hatte, das sich mit den Grenzen des
britischen Mandatsgebiets Palästina deckte, war hingegen bereits Mitte der
fünfziger Jahre deutlich geworden, dass eine sentimentale Verbundenheit mit dem
Westjordanland der politischen Vernunft unterzuordnen war. Bei der Wahl zwischen
"Ganz-Israel" (Erez Israel haSchIema) und einem kleineren israelischen
Staat mit einer jüdischen Bevölkerungsmehrheit entschied er sich für die zweite
Variante. Ben-Gurion ging davon aus, dass die im Westjordanland lebenden 600.000
Palästinenser "diesmal nicht weglaufen" würden. Er behielt recht. Der
militärische Erfolg wurde bald von der "Palästinensierung" des Nahostkonflikts
überlagert.
Die sozialdemokratische Mapaj und das von ihr getragene
linke Parteienbündnis, der Ma'arach, waren hinsichtlich der
Territorialfrage gespalten, was immer wieder zu heftigen Konflikten über den
territorialpolitischen Kurs der Regierung führte und eine Modifikation der
Politik der Stärke erschwerte. Erst in den achtziger Jahren gewannen in der
Mapaj nach und nach die Vertreter einer kompromissbereiten
Territorialpolitik vor allem durch den Einzug einer neuen Politikergeneration
die Oberhand. Gemeinsam war den linken Regierungsparteien jedoch, in den
besetzten Gebieten ein wichtiges Sicherheitspfand zu sehen. Der bereits wenige
Wochen nach dem Ende des Sechs-Tage-Kriegs vorgelegte Plan des Arbeitsministers
Jigal Allon war ein Kompromissvorschlag — auch gegenüber den gegensätzlichen
Haltungen in seiner eigenen Partei. Allon ging von sicherheitsstrategischen
Überlegungen aus und schlug eine Teilung des Westjordanlands nach dem Prinzip
"Land gegen Frieden" vor. Im Jordangraben sollten in einem zu annektierenden,
zehn bis zwanzig Kilometer breiten Streifen israelische Grenzsiedlungen
entstehen. Zusammen mit weiteren Annexionen im Norden und Osten von Jerusalem
sah der Plan schließlich vierzig Prozent des Westjordanlands als israelisches
Gebiet vor.
Der Allon-Plan wurde nie zur offiziellen Marschroute der
israelischen Politik, aber doch in Teilen umgesetzt. Noch 1967 bot die
"Regierung der Nationalen Einheit" einen einseitigen Ruckzug vom Golan und aus
dem Sinai gegen einen Friedensvertrag an, hinsichtlich des Westjordanlands
erwartete sie hingegen territoriale Zugeständnisse Jordaniens im Bereich von
Israels "Wespentaille" bei Netanya. Um den Sicherheitsanspruch zu
unterstreichen, entstanden bereits im Herbst 1967 die ersten jüdischen
Stützpunktsiedlungen im bis dahin dahin kaum landwirtschaftlich genutzten
Jordantal, aber auch in der Gush-Ezion-Region zwischen Jerusalem und Bethlehem
sowie im Großraum Jerusalem. Zehn Jahre später gab es knapp ein Dutzend dieser
Siedlungen mit lediglich 5.000 Bewohnern, von denen 2.000 in Kibbuzim an der
unwirtlichen Westseite des Toten Meeres lebten.
Parallel dazu begannen nationalistisch-messianisch inspirierte
Juden, im Westjordanland Fuß zu fassen. Ihre Siedlungen waren illegal und wurden
nicht von der Regierung gefördert, wurden aber, um absehbare Konflikte mit den
Siedlungsaktivisten zu vermeiden, auch nicht verboten. Zunächst agierten die
Siedler im Rahmen der Nationalreligiösen Partei, die zuvor beständiger
Koalitionspartner der Arbeiterpartei war, nun aber, bedingt durch einen
Generationswechsel und die Gebietseroberungen von 1967, eine enorme Rechtswende
erlebte. Aus ihr ging 1974 die radikale Siedlerbewegung Gush Emunim
hervor, die sich als religiös-zionistische Erneuerungsbewegung verstand und in
den folgenden Jahren zum ideologischen und organisatorischen Zentrum der
Siedlungsaktivitäten im Westjordanland wurde. Ihre Ideologie besteht aus vier
Kernpunkten. Die Gründung Israels sieht sie als Teil eines Erlösungsprozesses,
zu dem auch die Eroberung und Inbesitznahme von "Ganz-Israel" gehört.
"Ganz-Israel" sei heiliges Land, das, einmal erworben, nicht mehr zurückgegeben
werden dürfe. Vom säkularen Materialismus degenerierte Juden würden durch die
enge Verschmelzung mit dem Land in der Siedlerarbeit das "wahre Judentum"
wiederentdecken und gleichzeitig das jüdische Volk der Erlösung (Ge'ulah)
näherbringen. Die staatlichen Institutionen seien zwar Ausdruck göttlichen
Willens, könnten aber angegriffen werden, wenn sie heiliges Land an Nichtjuden
abträten.
Nach dem Regierungswechsel von 1977 erlebte Gush Emunim
einen rasanten Aufschwung. Die Siedlerbewegung profitierte ebenso wie der Likud
von einem ideologischen Vakuum, das mit dem Niedergang des Mamlachtiut
entstanden war Mit der Euphorie nach 1967, aber noch mehr mit der
Desorientierung nach 1973, wuchs das Bedürfnis nach einer neuen ideologischen
Unterfütterung der Bindung an das (neugewonnene) Land. Dessen Aneignung wurde
nicht mehr, wie es die sozialistischen Zionisten jahrzehntelang getan hatten,
über die Arbeit säkularer, opferwilliger Pioniere legitimiert. Statt dessen
wertete der Likud mit dem Ziel, eine neue Kollektividentität zu formen, die
territoriale Komponente des Zionismus auf und betonte die ursprünglichen,
historischen Bindungen der Juden an das Land. So stellte Menachem Begin in
seiner Regierungserklärung vom 10.Juni 1977 fest: "Das Jüdische Volk besitzt ein
historisches, ewiges Recht auf Erez Israel, das Erbe unserer Vorfahren -
ein Recht, das unveräußerlich ist"*. In seinem Wahlprogramm war der Likud noch
deutlicher geworden. Aufgrund dieser historischen Rechte "werden Judäa und
Samaria keiner fremden Regierung übergeben. Zwischen dem Meer und dem Jordan
[nicht darüber hinaus, wie die Cherut-Partei Begins nach 1948 noch
gefordert hatte] wird es nur israelische Souveränität geben". Die militärische
Eroberung desWestjordanlands galt der neuen Regierung aus historischen
Rechtsgründen als gerechtfertigt, blieb aber nach wie vor de facto mit
Sicherheitsargumenten verknüpft, über die allein ein breiter nationaler Konsens
in Fragen der Territorialpolitik hergestellt werden konnte.
*Anm.: Diese Aussage wurde nicht erst von Begin im
politischen Zusammenhang bebutzt. Sie ist uralt. Sie ist auch Bestandteil der
Unabhängigkeitserklärung vom 14.Mai 1948.
Vor dem Hintergrund dieser ideologischen Wende änderte sich
Ende der siebziger Jahre die israelische Rechtsgrundlage für Bodenenteignungen
im Westjordanland. Enteignungen waren nach einem Urteil des Obersten
Gerichtshofs aus den siebziger Jahren nur aus "Gründen der nationalen
Sicherheit" gerechtfertigt. Durch die Requirierung von Gebieten vor allem im
Jordantal und südlich von Jerusalem hatte sich Israel zwischen 1967 und 1977 in
den Besitz von einem Viertel des Bodens gebracht. Die generalstabsmässig
geplanten Siedlungsprojekte der neuen Regierung, für die nach seiner Ernennung
zum Landwirtschaftsminister Ariel Sharon verantwortlich war, benötigten aber
größere Flächen im Kernbereich des Westjordanlands. Die Sicherheitsklausel
behinderte jedoch großflächige Enteignungen, da sie Arabern ein Klagerecht
einräumte.
Im Fall der geplanten Siedlung Elon Moreh kam es 1979 zu einem
richtungweisenden Prozess, den enteignete Araber angestrengt hatten. Anders als
Likud und Gush Emunim sah Chaim Bar-Lev, Generalsekretär der
Arbeiterpartei und ehemaliger Generalstabschef, in Siedlungen wie Elon Moreh,
die innerhalb dicht besiedelter, arabischer Gebiete lagen, ein hohes
Sicherheitsrisiko. Sie seien ein leichtes Ziel für Anschlage und müssten im
Krieg von Soldaten unter großem Aufwand verteidigt werden Das Gericht erklärte
die für Elon Moreh vorgenommenen Enteignungen daraufhin für unrechtmäßig, so
dass die von der Likud-Emunim-Allianz angestrebte flächendeckende
Besiedlung gefährdet war. Doch bereits im April 1980 hebelte die Begin-Regierung
das Urteil durch einen Beschluss aus, nach dem Enteignungen keiner
Rechtfertigung durch Sicherheitsargumente mehr bedurften. Als "Staatsland"
enteignet oder als Privateigentum erworben, befanden sich 1996 fünfzig Prozent
des westjordanischen Bodens in jüdischer Hand.
Beim Bau neuer Siedlungen kooperierte die Likud-Regierung eng
mit Gush Emunim, der 1981 die kommunale Selbstverwaltung für die Juden im
Westjordanland übertragen wurde, obwohl sie nur ein Fünftel der Siedler stellte.
Neue Siedlungen wurden zunächst verstreut im zentralen Bergland von Samaria
angelegt, zumeist auf Anhöhen im Einzugsbereich der arabischen Dörfer. So konnte
mit kleinen Orten - zwei Drittel der jüdischen Siedlungen im Westjordanland
haben weniger als 300 Einwohner - und entsprechenden Straßenverbindungen relativ
viel Raum kontrolliert werden. Die Likud-Regierung setzte erstmals das
ideologische Programm einer "Judaisierung" des Westjordanlands politisch um und
stützte es durch demographische Argumente zusätzlich ab:
Die neuen Siedlungen sollten den urbanen Großraum Tel Aviv
entlasten. Östlich von ihm ist heute ein Drittel der inzwischen über 140
Siedlungen konzentriert. Im nördlichen Teil von Samaria finden sich die
jüdischen Niederlassungen hingegen nur verstreut. Ein weiteres Dutzend liegt
zwischen Jerusalem und Jericho, und mehr als dreißig haben sich südwestlich von
Bethlehem zwischen die arabischen Dörfer gedrängt.
1996 gab es nach offiziellen Angaben etwa 130.000 jüdische
Siedler im Westjordanland. Die Friedensbewegung bezweifelt diese Zahlen.
Überhöhte Angaben sollten lediglich der Forderung nach neuen Siedlungen
Nachdruck verleihen, obwohl viele Häuser in den bestehenden Orten leer stünden.
Auf jeden Fall sind die Etappensollzahlen längerfristiger Pläne, die zwischen
500.000 und l ,5 Millionen neue Bewohner anvisierten, nicht erreicht worden. Zum
einen hemmten die Große Koalition (Shamir/Peres) mitsamt der Inflationskrise
Mitte der achtziger Jahre und die Regierungszeit Yitzhak Rabins zwischen 1992
und 1995 den Bau neuer Siedlungen, auch wenn beide weder den natürlichen
Bevölkerungszuwachs noch den Ausbau bestehender Orte verhinderten. Selbst unter
Rabin nahm die Zahl der Siedler um 25.000 zu - Indiz einer halbherzigen Politik,
aber auch - wie bereits nach 1967 - des Versuchs, Konflikten mit den zum Teil
militanten Siedlern aus dem Weg zu gehen.
Ein rascherer Zuwachs wurde außerdem dadurch behindert, dass
die "Gebiete" - so die im Unterschied zu "besetzte Gebiete" oder "Judäa und
Samaria" ideologisch unverfängliche Bezeichnung des Westjordanlands in Israel -
trotz ihrer Nähe zum Zentrum des Landes infrastrukturell unterentwickelt und mit
Gefahren für die hinter Sicherheitszäunen lebenden Siedler verbunden sind. Als
Anfang der achtziger Jahre die Zahl der Siedlungsinteressenten zurückging,
änderten Regierung und Gush Emunim ihr Konzept. Bis dahin hatten sie das
Ideal eines "wiedererwachenden Juden" propagiert, der durch die Siedlungsarbeit
seine religiösen Wurzeln finden könne. Es nahm die religiöse Motivation vieler
frühzionistischer Siedler auf, lehnte aber das sozialistisch-säkulare
Pionierbild ebenso ab wie einen urbanen Lebensstil. Viele Siedler in den
besetzten Gebieten sehen sich heute als die einzigen tatsächlichen, den
zionistischen Grundsätzen treuen Pioniere. Doch die geplante Massenbesiedlung
war nicht allein durch eine bodenverbundene Erneuerungsbewegung zu erreichen.
Hohe Subventionen, Steuererleichterungen und attraktive Wohnanlagen sollten
neben ideologischen "Kreuzrittern" nun auch säkulare, an guter Luft und
günstigen Häusern interessierte Familien in Siedlungen locken, die als
Pendlervorstädte für eine urbane Mittelschicht angelegt wurden.
Aus dem Kapitel "Land ohne Frieden" von Habbo Knoch
(in Davids Traum,
Bleicher 2000)
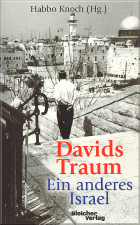 |
Ein anderes Israel:
Davids Traum
[Bestellen]
Habbo Knoch (Hg.)
Gebundene Ausgabe - 459 Seiten
Erscheinungsdatum: 2000
ISBN: 3883500496
Preis: 25.00 Euro
Bleicher Verlag
www.bleicher-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten
|
Anmerkungen und weiterführende Information:
34 NEW SETTLEMENT SITES
ESTABLISHED SINCE '01 ELECTIONS
hagalil.com
16-10-2002 |