|
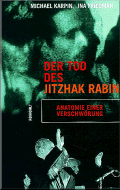
Der Tod des Jitzhak Rabin
Der Weg zum 4.11.1995
[BESTELLEN]
Kapitel 5: American Connection
Teil 6
Aufruf zur Gewalt durch ein angesehenes Mitglieder des
rabbinischen Establishments:
Der Fall Hecht
Im Juli 1995 waren die Angriffe auf Rabin so
heftig und allgemein geworden, daß dem Premier eine grimmige
Bemerkung über «eine kleine Gruppe Rabbiner in Amerika» entfuhr,
«die man besser als Ayatollahs bezeichnen sollte».
Anlaß dieser spitzen Bemerkung war ein
Vorgang, der gewiß als Krönung der Hetzkampagne gegen Rabin in die
Geschichte eingehen wird: der Aufruf zur Gewalt durch eines der
angesehensten Mitglieder des rabbinischen Establishments, Rabbiner
Abraham Hecht.
Mit seinen dreiundsiebzig Jahren war Rabbiner Hecht ein Mann von
großem Einfluß. Der New Yorker Kardinal O'Connor hatte ihm eine
Audienz beim Papst verschafft. Bürgermeister Giuliani hatte ihn bei
seiner Amtseinführung im Dezember 1993 auf die Ehrentribüne gebeten.
Als er im Dezember 1994 New York besuchte, hatte auch Rabin Hecht
Zeit und besondere Aufmerksamkeit gewidmet und ihn über die
Fortschritte des Osloer Prozesses unterrichtet, was der Rabbiner mit
stoischer Ruhe aufnahm. Hecht galt zwar nicht als Halacha-Autorität,
doch als Leiter der 54o-köpfigen Rabbinical Alliance of America war
er als Mann mit exzellenten Beziehungen geschätzt, der die Karriere
junger Kollegen voranbringen konnte. Schon früh in seiner Laufbahn
hatte er sich politischen Tätigkeiten gewidmet, und während es mit
ihm steil bergauf ging, unterstützte er Rabbiner Kahane und schloß
sich Dov Hikinds United Jewish Coalition an. Auch war er eine Säule
des Konservatismus in Fragen, die über die Grenzen der Halacha
hinausgingen.
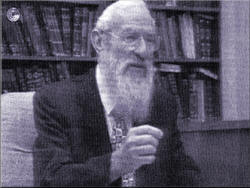 Rabbi
Abraham Hecht Rabbi
Abraham Hecht
Als er sich 1989 für Giuliani einsetzte, verkündete er, sein
Kandidat werde in einer von Übeln wie vorehelichem Sex, Abtreibungen
und homosexuellen Verbrechen korrumpierten Stadt endlich aufräumen,
und er unterstützte (wie der örtliche Ku-Klux-Klan) die milde
Bestrafung eines Mörders durch einen texanischen Richter, weil
dessen Opfer nach dem Wort des Richters «Schwuchteln» waren.
Über ein halbes Jahrhundert lang war Rabbiner
Hecht mit der Shaare-Zion-Synagoge am Ocean Parkway in Brooklyn
verbunden gewesen, mit einer Gemeinde aus überwiegend reichen,
syrischstämmigen Juden. Vielleicht haben sie nicht bemerkt oder
waren nicht besorgt darüber, daß ihr geistlicher Führer die
Heiligkeit von Groß-Israel vor allen anderen Werten verkündete. Nach
dem 19. Juni 1995 jedoch war es schwieriger, gleichmütig zu bleiben.
Denn an jenem Tag sprach Hecht vor einer Versammlung der
International Rabbinical Coalition for Israel - einer Organisation
von 3000 orthodoxen Rabbinern zur Rettung der besetzten Gebiete vor
dem Friedensprozeß - und machte dabei eine erschreckende Bemerkung:
Die Aufgabe irgendeines Teils des biblischen Lands Israel sei eine
Verletzung des jüdischen Religionsgesetzes, erklärte er seinen
Zuhörern, und so sei es erlaubt und notwendig, Rabin und alle seine
Helfer zu töten.
Die Reaktion unter den Zuhörern war gemischt.
Viele der Rabbiner unterschrieben eine Erklärung, in der Hechts
Ansichten unterstützt wurden. Anderen verschlug es die Sprache. Was
immer sie über den Sinn des talmudischen Gebots Din Rodef insgeheim
gedacht oder im vertraulichen Gespräch gesagt haben mochten, mit der
öffentlichen Verkündung eines solchen Urteilsspruchs ging Hecht
entschieden zu weit. Danach besuchten ein paar Kollegen Hecht in
seinem Brooklyner Büro und baten ihn inständig, seine Aussage
zurückzuziehen. Doch Hecht blieb unerbittlich. «Ich spreche nicht
für mich, sondern für das jüdische Gesetz», erklärte er, «und die
Aufgabe von Gebieten ist ein schweres Verbrechen im Judaismus».
Tatsächlich verschickte Hecht in den Monaten darauf Briefe an
amerikanische Rabbiner, mit Kopien für die israelischen Kollegen, in
denen er seine Worte wiederholte. Im August 1995 nutzte er das Forum
der Jewish Press für einen offenen Brief «an alle Rabbiner in den
USA», in dem er bekräftigte, daß «die Thora den Einsatz der
äußersten Mittel gegen jene gestattet, die unseren jüdischen
Mitmenschen Schaden zufügen». Darüber hinaus erklärte er, die
israelischen Offiziere, die nach Amerika geschickt wurden, um den
Osloer Friedensplan zu erläutern, seien «hier nicht erwünscht, und
wir müssen bereit sein, sie als das bloßzustellen, was sie sind:
Feinde des jüdischen Staates und des jüdischen Volkes.»
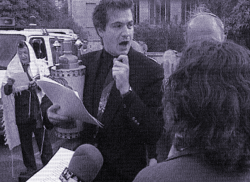 Avigdor
Eskin vor Rabins Wohnung: Avigdor
Eskin vor Rabins Wohnung:
Der Fluch "Pulsa de Nura"
Am 9. Oktober 1995 bekundete Rabbiner Hecht im New York Magazine,
ihm sei «buchstäblich schlecht» wegen des Friedens-Prozesses, «denn
er frisst mich bei lebendigem Leibe auf».
Auf die Frage, wie er sich fühlen würde, sollte jemand aus seiner
Erklärung vom Juni den Schluss ziehen, dass er das Recht habe, Rabin
zu töten, antwortete Hecht: «Ich würde gar nichts fühlen. Rabin ist
kein Jude mehr. Dieser Mann hat so viel Schaden angerichtet. Das
kann ich ihm nicht vergeben.»
Zur umstrittenen Erklärung selbst sagte er: «Ich habe doch nur
gesagt, dass gemäß dem jüdischen Gesetz jede Person - nehmen Sie,
wen Sie wollen -, die willentlich, bewusst und absichtlich Menschen
oder Eigentum oder den menschlichen Reichtum des jüdischen Volkes
einem fremden Volk überantwortet, sich der Sünde schuldig macht, die
unter Todesstrafe steht. Und bei Maimonides - zitieren' Sie mich
ruhig - heißt es ganz klar: Wenn ein Mann ihn tötet, hat er eine
gute Tat vollbracht.»
Wie, so fragte sein Gesprächspartner, könne dieses Prinzip mit dem
Gebot «Du sollst nicht töten» vereinbart werden?
«Das Gebot sagt, ich soll nicht morden, und nicht, 'Du sollst nicht
töten'», erklärte Hecht mit einem Glanzstück semantischer Akrobatik.
«Wenn es sagt 'Du sollst nicht töten', kann man ja nicht in den
Krieg ziehen. Und auch keine Hühner schlachten.»
In der letzten Oktoberwoche gab Hecht, inzwischen überall gefragt,
dem Korrespondenten des ersten israelischen Fernsehens, Ya'akov
Ahimeir, ein Interview, in dem er nachdrücklich wiederholte: «Ich
habe gesagt, Maimonides zufolge gilt für jeden, der Land oder
Menschen Israels an Fremde aushändigt - dass jeder, der rasch genug
zur Stelle ist, das Vorrecht hat, ihn zu töten.»
«Welcher Schluß ist daraus zu ziehen?» fragte Ahimeir, erstaunt,
dass jemand sich derart vor laufender Kamera äußerte. «Dass, Gott
bewahre, dem Ministerpräsidenten von Israel Schaden zugefügt werden
sollte?»
«Nein, nein, --»
«Sie sagen, daß jeder, der -»
«Ja», bestätigte Hecht. «Aber ich hatte nicht das Vorrecht.»
«Was meinen Sie damit, 'Ich hatte nicht das Vorrecht'?»
«Ganz einfach. Er lebt noch», sagte Hecht lachend.
Ahimeir war über das Material, das er auf Band hatte, so bestürzt,
daß er beschloß, es nicht zu senden, um nicht Gefahr zu laufen, daß
er oder sein Sender der Mordhetze angeklagt würden. Erst nach dem
Attentat gab er das Interview frei.
Rabbiner Hechts Ausfälle waren die klarsten in aller Offenheit
ausgestoßenen Hetzworte. Als angesehenes Mitglied des orthodoxen
rabbinischen Establishments hörten oder lasen Hunderte von Rabbinern
seine Tiraden. Nur eine Handvoll widersprach ihnen öffentlich.
«Die Stimme Hechts ist nicht die eines einsamen, verrückten
Extremisten», fühlte sich das New York Magazine verpflichtet zu
erklären, als es das Interview brachte, «sondern die eines
wachsenden Chors jüdischer Militanter, die die Grenze einer
berechtigten Diskussion überschritten haben und sich das Recht
herausnehmen, zur Gewalt aufzurufen - und selbst Gewalt zu üben.»
In diesem Netz war auch der republikanische
Bürgermeister von New York, Rudolph Giuliani, gefangen.
Ehrengast bei seiner Amtseinführung war Dov Hikind, ein beliebter
Politiker Anfang Vierzig, der mal als offenherzig und schlagfertig,
mal als schrullig und laut beschrieben wird. Er war auf der Liste
der Demokraten in das Parlament des Staates New York gekommen und
hegte Hoffnungen, eines Tages den Weg nach Washington zu schaffen.
Hikind, 1950 im Brooklyner Distrikt Williamsburg geboren, wuchs in
der grauen Welt eines selbstauferlegten Ghettos auf, das die
orthodoxen Juden als Bollwerk gegen die Assimilation errichtet
hatten. Als Sohn von Holocaust-Überlebenden, die sich 1947 in New
York niedergelassen hatten, fühlte er sich von Kahanes Evangelium
angezogen, das die Zukunft der amerikanischen Juden in
apokalytischen Tönen zeichnete, und 1970, als er am Queens College
studierte, schloß er sich der Jewish Defense League (JDL) an. Er
beteiligte sich an deren Patrouillengängen, die die Bewohner der
jüdischen Viertel vor der Gewalt armer und zorniger Schwarzer
schützen sollten. Hikind gewann unter den jungen «Milizionären»
rasch den Ruf eines geborenen Anführers, der sich besonders bei den
«Kommandounternehmen» der JDL und anderen Protestaktionen hervortat.
Zusammen mit neun Bundesgenossen wurde er erstmals festgenommen, als
die Gruppe die Amtsräume der sowjetischen UN-Botschaft stürmte und
sich mit Handschellen an das Tor fesselte. Als Zugabe stürmte er
gemeinsam mit einem anderen JDL-Aktivisten die ägyptische Botschaft
und entfachte eine Schlägerei, bei der drei Botschaftsangehörige
verletzt wurden.
Derlei Gebaren mag Hikinds Karriereaussichten in der Politik nicht
verbessert haben, doch es war Qualifikation genug, um von Rabbiner
Kahane zur rechten Hand in der JDL erkoren zu werden. Seitdem lernte
er eine ganz andere Spielart politischer Bildung kennen. Hikind zog
sich 1973 offiziell aus der Führungsriege der JDL zurück und wurde
Chef der SOIL (Save Our Israeli Homeland), einer neuen
Kahane-Gründung, der Juden auf den Leim gehen sollten, die sich vom
kriegerischen Gehabe der JDL abgestoßen fühlten.
Kahane hatte sein Hauptquartier inzwischen nach Jerusalem verlegt,
befehligte jedoch von hier aus immer noch die New Yorker
Operationen. Wie er arbeitete, geht aus einem Brief an ein
Führungsmitglied der JDL hervor (der der
Village Voice
zugespielt wurde):
«SOIL unter Dov H. ist ein gutes Beispiel dafür, was gemacht werden
kann. Ich denke, wir sollten Dov zum nächsten Vorstandstreffen [der
JDL] einladen, damit er erklärt, was getan wurde und wird. Alle
SOIL-Namen sollten diskret der JDL überlassen werden, die diese
Leute erst viele Wochen später kontaktieren darf, ohne zu sagen, daß
man die Adressen von SOIL hat. Arbeiten Sie eng mit Dov zusammen.
Ich habe ihm gesagt, er soll Ihnen zuhören.»
Und er lauschte und lernte gut. Zwanzig Jahre
später nutzte Hikind immer noch den Namen der angeblich moderaten
SOIL, um Zulauf für Demonstrationen gegen das Osloer Abkommen zu
gewinnen.
Hikinds Assistent bei der SOIL war Victor Vancier, ein stämmiger
junger Mann, dessen hauptsächliche Arbeit darin bestand, Sprengsätze
und Molotowcocktails zu basteln. Seinen Dutzenden von gewalttätigen
Attacken auf Schwarze, Mitarbeiter sowjetischer Einrichtungen und
Araber verdankte er die Aufnahme in die «Terroristen»-Kartei des
FBI. Man konnte ihn schließlich festsetzen und vor Gericht stellen.
Er hatte einen Bombenanschlag auf eine sowjetische
Diplomatenresidenz in New York verübt sowie während eines Auftritts
der Moiseyev Dance Company einen Kanister Tränengas in die
Metropolitan Opera geworfen. Im Oktober 1987 wurde Vancier zu zehn
Jahren Haft in einem Staatsgefängnis verurteilt, doch schon nach der
Hälfte dieser Zeit wurde er entlassen und avancierte zu einem Star
der jüdischen Medien New Yorks.
 http://www.jtf.org http://www.jtf.org
Hear
Jewish Task Force
In Zev Brenners Samstagabend-Talkshow «Talkline»
pries er Baruch Goldstein als «Zaddik» (heiliger Lehrer) und nannte
Rabin einen «Verräter und Judenmörder». Als Gastmoderator für zwei
Sendungen im Kabelfernsehen, «Positively Jewish» und «Jewish Task
Force», nutzte er die Gelegenheit zu Tiraden gegen Schwarze, Araber
und NichtJuden im allgemeinen.
Wundersamerweise fiel der Schatten von Vanciers Verbrechen nie auf
seinen Chef bei der SOIL, obwohl Hikind selbst ähnlicher
Machenschaften verdächtigt worden war.
1976 stand er vor einem Bundesgericht, weil er nach der Stürmung der
nach Entebbe entführten Air-France-Maschine durch ein israelisches
Kommando eine Rauchbombe in die ugandische UN-Mission geworfen
hatte. Ein Jahrzehnt später verdächtigte ihn das FBI, an der Planung
einer Serie von sechs Bombenanschlägen gegen arabische Ziele in New
York, Massachusetts und Kalifornien beteiligt gewesen zu sein -bei
denen ein Mensch getötet und mehrere verletzt wurden -, doch Beweise
gegen ihn waren nicht aufzutreiben...
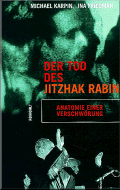 »»»
pp. 225 »»»
pp. 225
[Frühere Kapitel]
Aus dem Buch von
Michael Karpin und Ina Friedman:
Der Tod des Jitzhak Rabin
- Anatomie einer Verschwörung
[BESTELLEN]
hagalil.com
04-11-2004 |