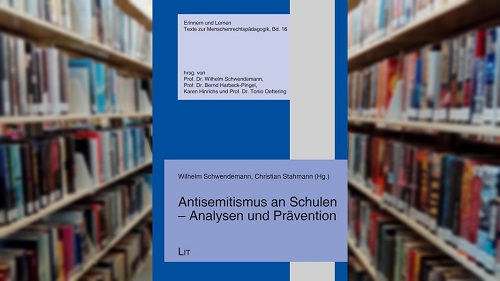Im vorliegenden Band sind Beiträge versammelt, die anlässlich der ersten Freiburger Fachtagung 2022 zur Antisemitismusprävention an Schulen entstanden sind. Die Beiträge beschäftigen sich aus wechselnden Perspektiven damit, wie der Religionsunterricht mit antisemitismuskritischen Bildungsinhalten präventiv wirksam werden könnte.
Von Nicole Noa-Pink
Die Tagung stellte sich dieser Herausforderung, indem sie historische, soziologische, bildungstheoretische und religionswissenschaftliche Perspektiven aufzeigt. Beteiligte Personen und Institutionen waren Prof. Dr. Julia Bernstein, die seit Jahren im Bereich Antisemitismus forscht, Dorothea Kleintges von OFEK e.V. Baden-Württemberg und Lehrbeauftragte der Ev. Hochschule Freiburg, Bijan Razavi von der Bildungsstätte Anne Frank Frankfurt für politische Bildung, Prof. Dr. Wilhelm Schwendemann, Professor für Ev. Theologie, Schulpädagogik und Religionsdidaktik an der Evangelischen Hochschule Freiburg und Direktor des Freiburger Instituts für Menschenrechtspädagogik, und Dr. Christian Stahmann, Evangelischer Schuldekan für den Kirchenbezirk Freiburg und Lehrbeauftragter an der Evangelischen Hochschule Freiburg.
In ihrem Vorwort gehen Wilhelm Schwendemann und Christian Stahmann zunächst auf die Phänomene des Antisemitismus und auf judenfeindliche Ressentiments ein und beschreiben unter Bezugnahme auf verschiedene Autoren und Autorinnen Forschungsergebnisse und Befragungen, wie und wo Antisemitismus an unseren Schulen auftaucht. Ziel sei es, Impulse für pädagogisches Handeln im schulischen Umfeld zum Schutz unserer Demokratie zu vermitteln.
In seiner Hinführung zu dem Thema setzt sich Wilhelm Schwendemann mit dem Verhältnis Antisemitismus und Rassismus und deren Unterschiede auseinander, indem er diese gründlich analysiert und historisch entwickelt. Antisemitistische Einstellungen von Schülerinnen und Schülern werden Erfahrungen von betroffenen jüdischen Mitschülerinnen und Mitschülern gegenübergestellt. In diesem Zusammenhang komme dem evangelischen Religionsunterricht eine Basisaufgabe zu, für dieses Thema zu sensibilisieren und Alternativen sichtbar zu machen. „Lehrende sind damit oft überfordert, die Zeichen zu erkennen oder auch erkennen zu wollen“ so ein Zitat von Wilhelm Schwendemann (s. S. 36).
Julia Bernstein gibt mit Florian Diddens im nächsten Kapitel Einblick in den Antisemitismus an Schulen aus der Perspektive der Betroffenen. Sie betiteln ihren Beitrag mit „Man muss da schon ganz schön auf Durchzug schalten, um nichts mitzubekommen“. Diese Aussage zieht sich durch den gesamten Artikel, angefangen von der Bagatellisierung des Antisemitismus in Deutschland über den schulischen Antisemitismus in Worten bis hin zu körperlichen Angriffen auf jüdische Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer. Die Betroffenen sind also – ich zitiere – „allen Erscheinungsformen des Antisemitismus ausgesetzt.“ (Julia Bernstein 2020) Als Beispiele werden verschiedener Vorfälle beschrieben, bei denen stets eine feindselige Atmosphäre entsteht, und jüdische Schülerinnen und Schüler stigmatisiert werden. Auf die Entwicklung des Antisemitismus nach der Shoah bis heute wird ergänzend eingegangen.
Der Beitrag von Reinhold Boschki, Elisabeth Migge und Valesca Baert-Knoll rückt besonders die religiösen Dimensionen der historischen und aktuellen Judenfeindlichkeit in den Vordergrund. Hierbei steht nicht das Lernen von geschichtlichen Daten und Ereignissen Mittelpunkt, sondern das Lernen am Beispiel – hier Elie Wiesel als Zeitzeuge und somit wertvolle Möglichkeit, die Erinnerung an den Holocaust zu thematisieren. Hinzu kommt die Notwendigkeit, Juden und Jüdinnen in der Gegenwart begegnen zu können und so Vorurteilen und plakativen Bildern in Religionsbüchern entgegenzuwirken, so Frau Prof. Bernstein.
Weiter geht es in diesem Buch mit einem Artikel von Christian Stahmann, der den Briefwechsel von Markus Jost und Heinrich Ewald im 19. Jahrhundert vorstellt. Die Begrifflichkeit des Wortes „Antisemitismus“ wird am Beispiel verschiedener Sprachphilosophen aus diesem Jahrhundert unter Bezugnahme der protestantischen Bibel erläutert. Es geht hierbei um die Identität der jüdischen / israelitischen Geschichte – eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Deutungen des Antisemitismus. Auch die „Nachgeschichte des Briefwechsels“, so Stahmann, birgt eine interessante Auseinandersetzung mit der Geschichte des Volkes Israels.
Jürgen Rausch gibt im Folgenden einen Einblick in „Intersektionale Pädagogik wider eine identitätsprägende gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“. Er stellt dar, dass es zunächst wichtig sei, Verständnis von sich selbst zu erlangen, um die Fähigkeit entwickeln zu können, Identität zur „Patchwork – Identität“ entwickeln zu können. Damit meint er verschiedene Phasen des Jugendalters eines jeden Menschen. Er beschreibt, wie wichtig Anerkennung und Zugehörigkeit in einer Gruppe sind, womit Jugendarbeit immer konfrontiert sei. Die Intersektionale Pädagogik käme ins Spiel, so Rausch, weil die Merkmale der intersektionalen Diskriminierung dann gegeben seien, wenn eine Person aufgrund verschiedener Persönlichkeitsmerkmale Opfer von Diskriminierung wird. Laut Rausch ist Intersektionale Pädagogik als Leitkonzept eine Antwort auf gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und hat als solche die Aufgabe, rassistische, antisemitische und rechtsextremistische Einflüsse zu verhindern. Dafür böten sich Jugendcamps, Ferien im Rahmen von Jugendarbeit, Sportcamps etc. unter pädagogischer Leitung an.
Im letzten Kapitel zeigt Bijan Razavi anhand seines Workshopkonzepts auf, inwieweit antisemitische Bild- und Erzähltraditionen im Kontext mit Israel und dem Nahostkonflikt stehen. Er fragt „Kritik oder Antisemitismus“? Dabei geht es um Absicht und Wirkung. Es kristallisieren sich verschiedene Ansätze dieses Workshops heraus: zum einen geht es um antisemitische Bildtraditionen und antisemitische Erzähltraditionen und inwieweit beides auf Israel angewandt wird. Außerdem geht es darum auch, wie Tatsachen verdreht werden und durch Falschinformationen manipuliert werden können. Zum andern geht es um Stereotypen, die die Jüdinnen und Juden und Israel dämonisieren. Antisemitismuskritische Bildungsarbeit wäre dafür geeignet, um Debatten über Israel und Nahost führen zu können, die frei sind von jeglichen antisemitischen Parolen.
Im Abschlusswort fasst Wilhelm Schwendemann die verschiedenen Formen des Antisemitismus noch einmal zusammen und stellt klar, dass Antisemitismus kein gesellschaftliches Randphänomen mehr sei und erläutert, wie vielschichtig sich Antisemitismus in unserer Gesellschaft zeigt. Der Fachtag habe hoffentlich sensibilisiert, um in die Zukunft zu schauen und dementsprechend Lehrpersonal qualifizieren zu können.
Dieses Lehrbuch eignet sich meines Erachtens hervorragend als Begleitlehrbuch zur Fortbildungs- und Präventionsarbeit. Es gibt unumwunden Einblick in die Geschichte des Antisemitismus, in den heutigen zunehmenden Antisemitismus, in die Verknüpfung der Stereotypen von damals zu heute, in die daraus resultierende Stigmatisierung von Jüdinnen und Juden, aber auch Israels, in die sowohl seelische als auch körperliche Verletzung von Jüdinnen und Juden. Es bietet Hilfestellung, um für „Zwischentöne“ von antisemitischen Angriffen sensibel werden zu können. Als besondere Unterstützung bei der Suche nach weiterführenden Informationen dienen die ausführlichen Literaturverzeichnisse im Anschluss an die Beiträge. Ein gelungenes Buch über einen gelungenen Fachtag, der einer Fortsetzung bedarf.
Wilhelm Schwendemann, Christian Stahmann (Hg.): Antisemitismus an Schulen – Analysen und Prävention